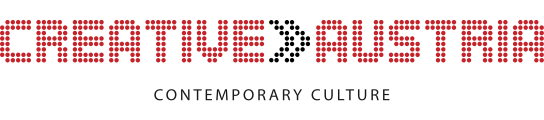Kreative Strategien für eine globale Lebensqualität
— Marina Fischer-Kowalski im Interview mit Hansjürgen Schmölzer
Wie kann eine global gerechte Entwicklung erreicht werden, wenn viele Ressourcen zu Ende gehen und die Weltbevölkerung trotzdem weiterwächst? Und welchen Beitrag können kreative Denk- und Lösungsansätze bei der Bewältigung dieser Probleme leisten? Diesen Themen kann man sich nur mit der Bereitschaft zu einem grundlegenden Perspektivenwechsel nähern. Marina Fischer-Kowalski formuliert in diesem Interview eine Reihe von überraschend schlüssigen, weil gleichzeitig überraschend einfachen Gedanken zu einigen dieser Fragen.
Das Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium hat unlängst eine neue Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich vorgestellt. Da heißt es: „Die Kreativwirtschaft soll gestärkt und weiterentwickelt werden, um künftig noch stärkere Impulse für Wachstum und Beschäftigung setzen zu können.“ Brauchen wir aus Ihrer Sicht mehr Wachstum?
Das ist eine ambivalente Frage. Wenn wir versuchen, auf dem Pfad zu bleiben, auf dem wir sind, dann brauchen wir mehr Wachstum, weil eine Menge Dinge auf diesem Pfad nicht ohne Wachstum funktionieren. Aber mein Vorschlag lautet natürlich: Wir sollten einen anderen Pfad suchen. Daher bin ich über die globale Finanzkrise 2008 gar nicht so unglücklich, weil sie einen Druck erzeugt hat, neue Wege zu suchen. Auch die Allgemeinheit musste erkennen, dass die alten Pfade nicht mehr so ganz funktionieren. Das ist mir ganz recht bei dem, was ich an wissenschaftlichen Einsichten habe.
Sie haben einmal gesagt: „Wenn viele ihre Möglichkeiten mit List und Courage am Schopf packen, können auch große systemische Änderungen zustande kommen.“ Was bestärkt Sie in dieser Hoffnung?
Beispiele. Das ist eine Hoffnung, die man immer wieder durch interessante neue Beobachtungen nähren muss. Und da muss man sich ein wenig anstrengen. Wenn man zum Beispiel sieht, wie glücklich alle darüber waren, dass der Weltklimagipfel in Paris doch Ergebnisse geliefert hat. Sehr viele haben damals erleichtert durchgeatmet und gemeint: Es geht ja doch etwas weiter. Aber seitdem ist nicht viel passiert. Es wenden sich alle vielmehr den Flüchtlingsströmen zu, den Grenzen und ähnlichen Themen. Obwohl das letztlich auch mit dem Klima zusammenhängt. Denn je mehr wir militarisieren, desto schwieriger machen wir es uns auch, mit dem Klima gut umzugehen. Insofern muss man die Hoffnungen auch aktiv nähren. Und ich nähre sie natürlich auch aus den empirischen Daten. Eine Studie von Julia Steinberger in Sussex zeigt weltweit für die letzten 40-50 Jahre, dass wir immer weniger Energie und Ressourcen brauchen, um das gleiche „Human Development Level“ im Sinne des Indexsystems der Vereinten Nationen zu erreichen. Alle fünf Jahre wird diese Ressourcenverbrauchskurve ein wenig flacher.
Aber es flacht sich nur das Ressourcenverbrauchswachstum ab. Nicht der Ressourcenverbrauch selbst. Richtig?
Ja. Aber wir können sagen, wir brauchen 2005 – das sind die letzten Zahlen aus dieser Studie – um 35 % weniger Energie, um denselben hohen HDI (Anm.: Human Development Index) von 0,85, also etwa den Entwicklungsstand, den wir in Österreich haben, wie im Jahr 1975 zu erreichen. Man kann sagen, die westlichen Industrieländer haben seit den 70er-Jahren im Bezug auf Ressourcen- und Energieverbrauch eine Sättigung erreicht. Das finde ich erfreulich. Aber das heißt natürlich weltweit noch nicht so viel. Denn diese aufstrebenden Ökonomien rattern mit einem Tempo nach oben, das die Abschwächung bei den reichen Industrieländern deutlich überkompensiert.
Ist der Human Development Index in diesem Zusammenhang als Parameter nicht auch problematisch, weil er ja impliziert, dass andere, die in dieser Entwicklung noch nicht so weit sind, einen Aufholprozess starten müssen. Worauf aus ethischer Sicht auch ein Anspruch besteht. Damit steigt aber gleichzeitig auch das Ressourcenverbrauchswachstum automatisch weiter. Ein ethisches Dilemma?
Ja. Aber gerade das Beispiel der Abflachung des Zusammenhangs zwischen Human Development und Ressourcenverbrauch gilt ja weltweit. Dieser Zusammenhang gilt eben nicht nur für die westlichen Industrieländer. Betrachtet man den Ressourcenverbrauch der westlichen Industrieländer genau, sieht man: Seit den 70er-Jahren geht das Bruttosozialprodukt immer noch hinauf. Und der Ressourcenverbrauch flacht sich ab. Das ist eine erfreuliche Feststellung. Weltweit kann man damit zumindest zeigen, dass die Länder nicht mehr so viel Energie und Ressourcen benötigen, um einen hohen Entwicklungsgrad zu erreichen. Wir haben also, wenn man so will, weltweit gesellschaftlich etwas dazu gelernt. Wir haben gelernt, mit weniger auszukommen. Das heißt aber nicht, dass wir das deswegen auch tun. Aber es bedeutet, dass wir es könnten. Und das ist schon einmal ganz gut.
Das hängt damit zusammen, dass die Technologien in ihrem Wirkungsgrad effizienter werden. Trotzdem ist aber wohl auch das Konsumverhalten jedes Einzelnen für den Ressourcenverbrauch mitverantwortlich. Wie sehr ist der Einzelne mit seiner Lebensgestaltung überhaupt dazu in der Lage, den Ressourcenverbrauch zu steuern?
Ich glaube, der Einzelne ist nicht so schrecklich wichtig. Der Einzelne ist aber insofern wichtig, als man Dinge, die man selbst erlebt hat, auch mit anderen kommuniziert und als Erfahrungen mitteilt. Aber der Einzelne steuert letztlich nicht seinen Ressourcenverbrauch. Das geschieht in erster Linie durch den Kontext und die Gesamtsituation, in die der Einzelne eingebettet ist. Das ist einerseits Technologie und andererseits auch das Funktionieren der Ökonomie sowie viele andere Kontexte. In Städten zum Beispiel: Wenn man ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz hat, so wie in Wien zum Beispiel, dann entfallen 40 % aller gefahrenen Kilometer auf den öffentlichen Verkehr. Und wenn man wie in Los Angeles ein miserables hat, dann fahren alle Leute mit dem SUV. Und das ist individuell dann nicht so ohne Weiteres zu steuern, weil man eben in Los Angeles ohne Auto nirgendwo hinkommt. Man muss gesellschaftlich die Gelegenheitsstruktur für das Handeln der Menschen verändern. Dann erst ändert sich auch das Handeln selbst. Zumindest bin ich als Soziologin davon überzeugt.
Wenn Sie von Gelegenheitsstrukturen sprechen: Wo könnten da Anreize in einem über das Regionale hinausgehenden Maß entwickelt werden?
Für den Ressourcenverbrauch sind natürlich das Design und die Verkaufsstrategien von Gütern ganz entscheidend: Kurze Lebensdauer, schnelle Abnützung, um nicht sogar von eingebauten Verfallszyklen im Produkt selbst zu sprechen, sind natürlich Gift für den geringen Ressourcenverbrauch. Das ist völlig klar. Ich glaube aber, dass man da wirklich regulativ eingreifen kann. Man könnte zum Beispiel verlangen, dass von allen industriell produzierten Gütern ein bestimmter Anteil aus sekundären Ressourcen erzeugt wird. Im Moment hat die ganze, zum Teil durchaus phantasievoll gewordene Recyclingindustrie ständig ökonomische Probleme, weil ein ordentliches Recycling auch etwas kostet. Die Ressourcen sind zwar teurer geworden, aber so schrecklich volatil, dass man nicht wirklich damit rechnen kann, dass man seine Produkte als Recycler erfolgreich absetzen kann. Hier könnte man regulativ eingreifen. Und das würde durchaus Sinn machen, weil es nicht einzusehen ist, dass für jene Länder, die sich später entwickeln als die reichen Industrieländer, dann überhaupt keine Ressourcen mehr übrig sind.
Da wird dann gleichzeitig das Argument schlagend: Wenn nur eine nationale Volkswirtschaft regulierend eingreift, dann lukrieren die anderen Länder daraus die Kosten – und damit Wettbewerbsvorteile, die durch solche Regulierungen entstehen. Wie kann man dem begegnen?
Da die reichen westlichen Industrieländer sowohl in ihrem Güterreichtum als auch in ihren Abfällen ein unglaubliches Depot an Ressourcen haben – wie niemand sonst auf der Welt – wird das in einer Zeit, in der Ressourcenknappheit droht, wirklich zu einer Chance. Wenn man die Recyclingindustrie nicht rechtzeitig auf solche technischen und ökonomischen Möglichkeiten einstellt, dann lukriert man diese Chance auch nicht im rechten Moment. Da bin ich aber eigentlich ganz zuversichtlich. Da geht es nicht um eine ewige Regulierung. Da geht es vielmehr um einen regulierenden Eingriff, der für eine bestimmte Zeit einen Impuls bietet, um eine Strategieänderung herbeizuführen. Ich finde das geht und das kann man machen. Wahrscheinlich nicht als einzelnes Land. Aber die Europäische Union kann das sehr wohl.
Ein wesentliches und nicht unproblematisches Thema bei Kreativleistungen ist der Patent- und Urheberrechtsschutz. Es gibt das fast unantastbare Paradigma in den Industrienationen, dass der Patentschutz eine unabdingbare Voraussetzung für den wissenschaftlichen und auch wirtschaftlichen Fortschritt sei. Ist das so?
Nein. Und man sieht auch jetzt in den Bereichen, in denen das illegalerweise oder auch legalerweise nicht mehr gilt, dass das nicht zum Schaden der Beteiligten ist. Es ist natürlich ein Riesengeschäft. Zum Beispiel in der Pharmaindustrie. Dort ist das besonders umkämpft. Die Pharmaindustrie entwickelt dadurch zwar Produkte, die für einen reichen Markt, aber deshalb nicht unbedingt für einen großen Markt sind. Das ist eine Fehlleitung, wenn sie so wollen: Gegen Malaria gibt es nichts Neues, denn das hat von den reichen Ländern niemand. Aber gegen Krankheiten, die in den westlichen Industrie- ländern verbreitet sind, da gibt es sehr wohl Entwicklungen, weil dort etwas gezahlt wird. Und da finde ich es offen gestanden ganz in Ordnung, dass Entwicklungsländer oder auch China diesen Schutz unterlaufen. Und das ist nicht zum Schaden der Kreativität oder des wissenschaftlichen Fortschritts. Am deutlichsten sieht man das ja in der IT-Branche, wo Apps, Spiele und weiß der Teufel welche guten Ideen entwickelt und verschenkt werden und sehr zur Bereicherung der intellektuellen Landschaft beitragen. Anscheinend lässt es sich mit diesen Mechanismen ja auch leben.
Von noch viel größerer Bedeutung als in der Pharmaindustrie ist der Patentschutz ja im Bereich der Welternährung. Wie kann man dem Problem beikommen, dass einige wenige Konzerne einen überwiegenden Anteil der Welternährungsproduktion kontrollieren?
Das halte ich für wirklich sehr problematisch. Eine der Hoff- nungen, die ich in diesem Zusammenhang nähre, ist: Langfristig untergräbt industrielle Landwirtschaft ihre eigenen Fundamente. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass wir mit industrieller Landwirtschaft auf Dauer die Welt ernähren können und sollen. Es versuchen ja immer wieder Teile der Weltlandwirtschaft, aus diesen Monopolen und aus diesen Verwertungsstrategien auszubrechen und andere Wege zu beschreiten. Das halte ich für ungeheuer wichtig. Inwieweit das erfolgreich sein kann und inwieweit es gegen diese Kontrolle des Saatgutes schlicht Revolten geben wird, in Afrika oder anderswo, das lässt sich nicht abschätzen. Aber das ist ein außerordentlich bedeutendes ethisches Problem.
Sie haben einmal gesagt: „Es muss einen globalen Aushandlungsprozess über die Nutzung unserer Ressourcen geben, sonst stürzen wir in die Barbarei.“ Wie könnte ein solcher Aushandlungsprozess, der dann auch tatsächlich Ergebnisse nach sich zieht, realistisch auf den Weg gebracht werden?
Im Moment betrachten wir das Weltklima, obwohl es sich an jedem Ort anders darstellt, schon ein Stück weit als ein Global Common, also ein gemeinsames Gut. Das machen wir bei Ressourcen bis jetzt überhaupt nicht. Wenn wir beispielsweise an Ressourcen wie Freshwater, also Süßwasserressourcen, denken. Die werden im Moment im Rahmen des Welthandels in ungeheurem Ausmaß – wir nennen das virtuell – gehandelt. Das heißt: Sie waren notwendig, um irgendein Gut zu produzieren, das dann gehandelt wird. Das ist in Regionen wie in Lateinamerika oder Teilen Asiens, wo es relativ viel Niederschlag gibt, nicht vordergründig problematisch. Es ist aber in vielen anderen Ländern schon heute ein Problem. Das Ergebnis ist beispielsweise, dass über diese Güter Länder wie die USA, die insgesamt betrachtet selbst über genug Niederschlag verfügen, dann aber gleichzeitig auch noch zum größten virtuellen Freshwater-Importeur werden, ohne dabei sichtbarerweise den Regen aus anderen Ländern „absaugen“ zu müssen. Hier kann ich mir vorstellen, dass ein Weg über Dokumentation und – wenn man so sagen will – Denunziation eine gewisse Wirkung haben könnte. Es geht um das Darstellen und das Sichtbarmachen dieser Prozesse. Was die Metalle und seltenen Erden anlangt, die nur an bestimmten Orten vorkommen und in einem unglaublichen Maße monopolisiert sind, es gibt, glaube ich, keinen Wirtschaftsbereich, der von so wenigen Konzernen kontrolliert wird wie der metallurgische Bergbau – das ist ein Problem, mit dem sich die Welt schon seit der Römerzeit herumschlägt. Das war schon damals ein Konfliktthema: Wem gehören die Silberminen und wie kann der römische Staat seine Soldaten noch bezahlen, wenn die Silberminen plötzlich wenig ertragreich werden.
Die Antworten von damals auf dieses Problem haben aber auch die folgenden zweitausend Jahre gegolten: Sie gehören dem, der die militärische Macht hat.
Das ist schon richtig. Aber der Römische Staat hat sich trotzdem geplagt, diese Macht über die Silberminen zu behalten. Und da hat natürlich auch die Natur ein Stück weit mitgespielt, indem manche Minen irgendwann einfach erschöpft waren und nicht so schnell wieder neue gefunden wurden. Und wir wissen ja, was aus dem Römischen Reich geworden ist.
Machen wir einen Sprung von den großen Ressourcenverbrauchern und jenen, die die Ressourcen kontrollieren, zu den Kreativen. Können die überhaupt etwas zur Verbesserung der Welt beitragen oder sind sie realpolitisch viel zu ohnmächtig?
Viele behaupten, dass die Künstler und die Kunst ein Sensorium für neue Möglichkeiten haben, Vorboten für neue Möglichkeiten sind und auch aufzeigen, welche überholten Möglichkeiten aus der Welt geschafft werden sollen. Und das in einer noch vorpolitischen Form signalisieren. Das halte ich für plausibel. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, welche Rolle die Kunst im Zusammenhang mit der fossilenergetischen Revolution gespielt hat, die von der französischen Revolution und von der Revolution 1848 begleitet wurde: Da hat die Kunst schon vorher eine neue Welt antizipiert, die auf der Ebene der politischen Phantasie und auf der Ebene der ökonomischen Tatsachen noch keineswegs Fuß gefasst hatte. Deshalb hoffe ich, dass es diese antizipatorischen Fähigkeiten der Phantasie in ihrer institutionalisierten Form als – im weitesten Sinn – Kunst, auch heute noch gibt.
Das Zeitalter der Aufklärung, das den vernunftbegabten Menschen mit den ihm „natürlicherweise“ zustehenden Menschenrechten ins Zentrum gerückt hat, hat ja zu den großen Revolutionen geführt. Zur Amerika- nischen Unabhängigkeit, zur Französischen Revolution. Daher könnte man meinen: Eigentlich sind wir vom Grundsatz her damit schon durch. Was kann jetzt noch kommen?
Das sehe ich ein wenig anders. Ich arbeite gerade an einer Studie über das Timing der Revolutionen. Die Frage lautet, wie das Timing von Revolutionen mit einem energetischen Übergang von einer landbasierten Biomasseökonomie zu einer fossilenergiebasierten zuerst Manufakturwirtschaft und in weiterer Folge industriellen Ökonomie zeitlich zusammenhängt. Und Sie würden sich wundern, wie eng das zusammenhängt. Diese ganzen Revolutionen, einschließlich der Russischen und der Chinesischen, finden in den jeweiligen Ländern in der ersten Anstiegsphase der Nutzung von Fossilenergie statt. In diesem ersten Übergang von einer agrarischen zu einer industriellen Produktionsweise. Präzise mathematisch modellierbar liegen alle großen Revolutionen bei einem Sprung des fossilen Energieverbrauchs zwischen 2 und 10 Gigajoule pro Kopf. Ungefähr 50 Länder sind in ihrem Verbrauch heute in diesem kritischen Bereich, nämlich Länder wie Afghanistan, Haiti und fast alle Länder im südlichen Afrika. Andererseits liegen von den insgesamt etwa 200 Ländern der Welt ungefähr 50 im obersten Bereich der fossilenergetischen Transition. Dieser Einstieg in Kohle, Öl und Gas wird in den anderen Ländern nie mehr in gleichem Maße erfolgen können, wie das in den reichen Industrieländern passiert ist, weil wir gar nicht so viel Fossilenergie haben. Von den Klimafolgen ganz abgesehen. Aber genau in dieser ersten fossilenergetischen Aufschwungphase haben auch heute jene Länder, die sich gerade in dieser Transition befinden, Myanmar, Bangladesh, oder Nepal zum Beispiel – alle diese Länder haben auch genau in dieser Periode ihre teils demokratischen, teils gescheiterten politischen Übergänge. Also, es ist noch nicht vorbei.
Diese Arbeit fußt auf der These, dass solche gesellschaftlichen Wechsel parallel mit dem Aufschwung im Energieverbrauch einhergehen. Könnte es aber nicht so sein, dass dieser Energieverbrauchswachstumsindikator nur in einer bestimmten historischen Periode Geltung gehabt hat. In der Industriellen Revolution war es die Energie, die man für den Systemwandel gebraucht hat. Heute stehen wir aber vor einer digitalen Revolution. Da ist ja nicht der Energieverbrauch per se das treibende Momentum, sondern der Zugang zur Information.
Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube ja auch nicht, dass die reichen westlichen Industrieländer in der Gegenwart durch eine Steigerung ihres Energieverbrauchs ihre sozialen Strukturen verändern. In den hochentwickelten Ländern spielen andere Mechanismen eine Rolle, die soziale Veränderungen größeren Ausmaßes auslösen können. Das hat etwas mit dem Technologieniveau zu tun. Die bevorstehende Entwicklung der Umstellung auf dezentralere erneuerbare Energien wird wohl auch gesellschaftliche Veränderungen nach sich ziehen. Wahrscheinlich nicht so revolutionär wie ich das vorher beschrieben habe, aber man soll nicht unterschätzen, wie viele Länder heute noch in genau dieser Niedrigenergiesituation sind, in der auch nur ein kleines Wachstum an Energieverbrauch nach einer Veränderung der gesamten sozialen Struktur verlangt – was auch unterdrückt werden oder scheitern kann.
Sprechen wir in diesem Kontext über die Rolle der Kreativen, auch in einem ökonomischen Sinn. Wenn man sich die Wirtschafts- und auch Kreativwirtschaftsstrategien der meisten hochentwickelten Länder ansieht, dann steht da überall gleich im Vorspann: Die Kreativwirtschaft wird einer der zentralen Treiber für den wirtschaftlichen Wandel sein. Dabei schwingt auch immer ein Paradigma der Skalierbarkeit von kreativwirtschaftlichen Innovationen als Ziel mit. Es geht immer ums Wachstum. Auf der anderen Seite beobachtet man aber auf einer sozialen Ebene eine immer größer werdende Verweigerungshaltung der Kreativen selbst gegenüber solchen auf unternehmerische Skalierbarkeit ausgelegten Lebensentwürfen. Macht man da eine Rechnung ohne Wirt?
Ein erheblicher Teil der Kreativwirtschaft ist ja überwiegend in der Werbung beschäftigt. Und insofern mit Wachstum schon sehr innig verbunden. Aber das Wesentliche am Kreativbereich dürfte dennoch sein, dass das auch ein neuer Typus eines Arbeitsmodelles ist, bei dem die in diesem Bereich Tätigen intrinsische Befriedigung suchen, die sie allerdings meist nicht unbedingt zu besonders reichen Menschen macht. Das ist für viele auch nicht das entscheidende Ziel. Sondern die Tätigkeit als solche soll etwas Erfreuliches, Sinnstiftendes und Befriedigendes sein. Man kann jetzt sagen, so wie in der alten Revolution die Lohnarbeit in den Städten entstanden ist und die bäuerliche Arbeit als Abhängigkeitsmodell weitgehend verdrängt hat, so wird sich wahrscheinlich auch mit der nächsten energetischen Transition die Arbeit wieder grundlegend verändern. Ich denke, die Kreativwirtschaft antizipiert da schon zum Teil ein neues Arbeitsmodell – möglicherweise im Guten wie im Bösen – mit viel sozialer Unsicherheit, mit unbegrenzter Arbeitszeit, die das ganze Leben durchdringt. Aber auch mit Modellen der inneren Befriedigung und der kommunikativen Lust, mit anderen gemeinsam oder allein etwas zu schaffen, das Bedeutung hat.
Mit der Industriellen Revolution ist die Lohnarbeit als Massenphänomen geschaffen worden. Und seither sprechen wir, wenn wir von Wirtschaft reden, immer auch von dieser Dualität: Arbeitsplätze schaffen einerseits, und einen Arbeitsplatz haben oder bekommen andererseits. Ist diese Dualität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überhaupt weiterhin gültig? Insbesondere in einem Bereich, in dem sich gerade auch andere kreative Lebensgestaltungsentwürfe entwickeln. In diesem Kontext stellt sich auch eine entscheidende Zusatzfrage: Viele, die im kreativwirtschaftsnahen Bereich tätig sind, leben in prekären Verhältnissen. Wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit diese Menschen Aussicht haben, aus diesem Prekariat herauszukommen?
Ich stimme ihnen zu. Diese Dualität Arbeitgeber, Arbeitnehmer gilt für diesen Bereich weniger. Ich erinnere mich an einen bekannten französischen Soziologen, Nicos Poulantzas, der die These hatte, dass diese vielen kleinen Selbständigen in ihren Bereichen auf eigenes Risiko und mit hohem Einsatz verschiedene wirtschaftliche und gestalter- ische Strategien ausprobieren. Und die Ideen, die wirklich erfolgreich sind, werden von der großen Industrie übernommen und dort hochprofitabel weitergeführt. Aber die anderen gehen dann auch wieder zu Grunde. Poulantzas sieht das Feld der kleinen Selbständigen als ein praktisches Experimentierfeld für die große Industrie, wo ohne großes Risiko etwas ausprobiert und erst dann aufgegriffen wird, wenn es schon ausgereift ist. Er sieht diese Einpersonenunternehmen als ein Opfer dieser Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Dualität. Ich bin aber nicht sicher, ob diese These erschöpfend ist. Denn ich vermute, dass dieses dominante Modell der 40-Stunden-Lohnarbeit als das lebensprägende Moment vom Schulabschluss bis zur Pension nicht das Arbeitsmodell der Zukunft sein wird. Andererseits sehen wir natürlich gleichzeitig, dass der Sozialstaat in vielen Bereichen unterminiert wird. Und damit werden all jenen, die nicht das Glück haben, in diesem Sozialstaatsmodell unterzuschlüpfen, große Risiken aufgebürdet.
Aber gerade auf diese Frage hat noch kaum ein höher entwickelter Sozialstaat – beispielsweise in Europa – irgendwelche brauchbaren Antworten entwickelt. Gleichzeitig setzt man bei der Suche nach neuen wirtschaftspolitischen Lösungen der Zukunft gerade auf diese überwiegend in einer sozialen Unsicherheit, wenn nicht gar im Prekariat, lebende Schicht der Kreativen. Kann das funktionieren?
Es gibt schon einzelne Elemente des Sozialstaates, die das reflektieren: Zum Beispiel die Bildungskarenz. Das ist etwas, das ich in meinem Bereich beobachten kann. Wenn Leute ihren Job verlieren oder kleine Betriebe nicht genügend Einkommen haben, um jemanden weiter beschäftigen zu können, werden Menschen oft für ein zwei Monate oder auch für ein halbes Jahr in Bildungskarenz „geschickt“. Und dann geht es wieder. Das sind Modelle, die im österreichischen Wohlfahrtsstaat auch die Kreativen begünstigen. In anderen Gebieten gibt es da natürlich viel weniger. Was man in diesem Kontext auch immer stärker beobachten muss, sind diese Muster von zwei oder drei Jobs, die jemand gleichzeitig macht. Einerseits hat man einen kreativen Job, andererseits irgendeinen Broterwerb beispielsweise in der Gastronomie etc.
Wenn man die soziokulturellen Milieus, in denen sich diese Menschen bewegen, näher ansieht, und die sind in den meisten Städten Europas relativ ähnlich: Haben Sie den Eindruck, dass dort Lebensmodelle als erstes ausprobiert werden, die auch abseits der Wachstumslogik der Nachkriegsjahrzehnte funktionieren können? Welchen Einfluss können solche soziokulturellen Milieus auf die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt haben?
Diese Wachstumslogik galt seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir nennen das auch „the great accelleration“, was sich da in den 50er- und 60er-Jahren abgespielt hat. Diese Logik wurde zum ersten Mal mit der Studentenbewegung, mit der Kulturrevolution 68 durchbrochen. Damals ist kulturell zum ersten Mal die Frage gestellt worden: Ist das das großartige Lebensmodell, dass wir jetzt alle wachsen und alle immer mehr konsumieren? Da gab es zum ersten Mal auch eine massive Konsumkritik. Von den Hippies bis zu den Anarchisten und dem ganzen bunten Spektrum, das sich in diesem Dunstkreis entwickelt hatte – und zwar weltweit: Von Japan bis Argentinien quer über den Globus. Diese kritische Haltung hat auch die Debatte der 70er-Jahre dominiert.
Die Debatte, aber nicht die Auswirkungen. Oder?
Doch. Das was ich am Anfang des Interviews zur Stagnation des Ressourcenverbrauchs gesagt habe, hat Anfang der 70er-Jahre in den westlichen Industrieländern begonnen. Der physische Verbrauch ist nicht mehr so stark gewachsen. Und das Bruttosozialprodukt ist ein bisschen weniger gewachsen. Dann gab es allerdings diese neoliber- ale Welle mit Thatcher und Reagan, in der man nur mehr gesagt hat: Jetzt müssen wir wachsen. In den 60er-Jahren ist gar nicht so viel von Wachstum die Rede gewesen. Da hat man das einfach gehabt. Nur: Diese neoliberalen Ansätze machen das jetzt zum eigentlichen politischen Ziel. Gerade, weil es nicht mehr ganz so leicht funktioniert. Aber ich glaube, dass diese neuen gesellschaftlichen Schichten der Gegenwart, wie damals die Hippies, ein vielleicht heute gar nicht mehr so minoritäres Konzept anderer Lebensweisen abgeben. Und das wird sich auch politisch auswirken.
Wenn man das in Verbindung zur jüngsten Steuerreform dieser Bundesregierung setzt: Darin ist ein Grundparadigma enthalten, das man auch quer über die Politik der meisten anderen europäischen Länder legen könnte: Man muss den Binnenkonsum durch Steuersenkungen anregen, um damit Wirtschaftswachstum zu generieren. Entspricht das einerseits den Lebensentwürfen der Menschen in diesen Ländern und andererseits auch einer auf Ressourcenschonung ausgelegten, wirtschaftlich sinnvollen Logik?
Ich denke es entspräche insofern – aber das hat das Steuermodell ja nicht wirklich ganz gebracht – einer nachvollziehbaren Logik, als es große soziale Schichten gibt, die wirklich zu arm sind und zu wenig Konsumchancen haben. Die in der Tat dringend für eine sehr vernünftige Befriedigung von Bedürfnissen eine größere Konsumchance haben sollten. Wo wirklich Verschwendung stattfindet, ist in den oberen Bereichen der Einkommenshierarchie. Und da gibt es dann nicht nur das Zweithaus, sondern das Dritthaus und das Drittauto und die SUVs, die wir in Wien herumfahren sehen, die aussehen, als würden wir einen Bürgerkrieg haben und man sich gegen Querschläger durch dicke Autos schützen müsste: Das sind ja Symptome einer verrückten Konsumhaltung. Aber die findet nicht in der Mitte oder im unteren Bereich der Gesellschaft statt.
Ist das nicht ein Phänomen, das es in Westeuropa gar nicht mehr so stark wie beispielsweise in den Ländern des früheren Ostblocks gibt, wo einige sehr rasch reich geworden sind und der Konsum sehr stark in den Mittelpunkt gestellt wird. Ist dieser Konsum zur Darstellung des eigenen Status in Westeuropa nicht schon wieder im Sinken?
Bei uns gilt es nicht mehr als fein, mit dem eigenen Konsum anzugeben. Aber wenn sie als Maßstab den Anteil der SUVs in den Städten nehmen: Der ist noch immer im Steigen. Da kann ich nicht den Eindruck gewinnen, dass das nicht mehr wichtig sei. Nehmen wir die jüngste Bankenkrise als Beispiel: Da sind eine Menge von Leuten in gehobenere Sozialschichten aufgestiegen, die bisher völlige Arbeitsplatzsicherheit hatten und sehr gut verdient haben. Die den ganzen Tag mit Geld zu tun haben. Und für die Geld auch privat eine große Bedeutung genießt. Die kommen jetzt plötzlich in den Bereich der Verunsicherung. Das hat gesellschaftliche Auswirkungen. Wenn die Angst bekommen, sie können sich die neueste Ausgabe des SUVs nicht mehr leisten, dann beunruhigt sie das. Das ist zwar nicht so spektakulär wie irgendwelche Oligarchen aus dem Osten, die da in irgendwelchen Schiorten kiloweise den Kaviar auf den Tisch knallen, aber es ist trotzdem dasselbe Phänomen. Wenn man sich an die 50er-Jahre im Westen erinnert: Da hat man es auch erlebt, dass die Leute so richtig geprotzt haben. Und dasselbe Phänomen haben wir jetzt im Osten.
Wenn man die Maslow´sche Bedürfnispyramide von unten nach oben auffüllt, und dabei die Basic-Needs einmal abgedeckt sind, dann geht es ja in Wahrheit nur mehr um eine Frage: Was macht im Leben Sinn? Und was macht glücklich?
Und was bringt einem Anerkennung. Das ist das eigentlich Heikle. Anerkennung und Aufmerksamkeit durch andere. Das wird zu einem knappen Gut. Um das zu erreichen – und das ist ungeheuer wichtig – gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, die je nach sozialen Gruppen auch unterschiedlich funktionieren.
Brauchen wir dann eine neue Strategie der Anerkennungsökonomie, um den materiellen Verbrauch reduzieren zu können? Die sozialen Medien sind in gewisser Weise ja ein solches Phänomen.
Die sind genau so etwas. Diese Möglichkeit, von anderen Resonanz für meine eigenen Meinungen und meine eigenen Selbstdarstellungen zu bekommen, das bieten die sozialen Medien. Und das scheint viele Leute sehr zu befriedigen. Diese Aufmerksamkeitsökonomie, die da neben der Geldökonomie existiert und mit ihr auch gar nicht unbedingt so eng verknüpft ist, die ist schon eine neue Form der Befriedigung, die unsere Gesellschaft zu bieten hat.
Könnte uns das ironischerweise helfen, den materiellen Ressourcenverbrauch zu reduzieren?
Ich denke schon. Dieses alte Konzept: Wenn man arm ist, ist man einsam, weil man gar nicht die Mittel hat, um sich im öffentlichen Raum zu bewegen, Verbindung aufzunehmen, das wird natürlich durch diese Medien verändert. Nicht für die heutigen 80-jährigen Frauen, aber für die nächste Generation an 80-jährigen Frauen.
Trotzdem scheinen die Volkswirtschaften den Zwängen der Wachstumslogik nicht zu entkommen. Es hat ja unterschiedliche Versuche gegeben, an Stelle des Bruttoinlandsprodukts andere Indikatoren auch als Leitmaßstab für die Politik zu setzen. Das Bruttoglücksprodukt in Bhutan zum Beispiel: Dazu haben Sie einmal gemeint: „Wenn alle Leute glücklich sind, dann ist das schön und fein, aber daraus folgt nichts.“ Haben Sie andere Vorschläge, wie man den ökologischen und geopolitischen Folgen des Wachstumsparadigmas entkommen könnte?
Es gibt verschiedene aktuelle Positionen zum Thema „Wachstumsrücknahme“ oder einer degrowth-Ökonomie. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie gut es gelingt, die wirtschaftliche Entwicklung vom Verbrauch der Ressourcen zu entkoppeln. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Bereiche, in denen sich sehr viel bewegen ließe, ohne dass dadurch das Lebens- und Entwicklungsniveau beeinträchtigt sein müsste. Der erste Bereich ist die Ernährung: Ein erheblicher Teil des Kalorienverbrauchs, insbesondere in den Industriestaaten, wird durch tierische Nahrung gedeckt. Aber gerade die industrielle Fleischproduktion ist extrem ressourcenvergeudend. Und der zweite Bereich ist das Bauen. Wir müssen verdichten. Das Zersiedeln in die Fläche zieht längerfristig unumkehrbare Ressourcenverbrauchsfolgen nach sich. Deshalb ist es auch besonders spannend, Strukturen und Konzepte von jetzt neu entstehenden Städten zu untersuchen. Hier ergeben sich interessante Optionen. Beispielsweise in den Bereichen der Ver- und Entsorgung. Der Fortbewegung. Ein aktueller Bericht des Worldwatch Institute zum Thema „Can Cities Be Sustainable?“ beschäftigt sich mit solchen Fragen. Und es lässt sich feststellen, dass gute Konzepte die Ressourcenverbrauchsbilanz um das 2- bis 3-fache verbessern können. Neben Raumentwicklungs- und Infrastrukturkonzepten spielt dabei aber vor allem auch die Gestaltung der kleinräumigen sozialen Strukturen und die soziale Gestaltung der Bedarfsversorgung eine wichtige Rolle. Da geht es nicht nur um Ideen aus dem unmittelbaren Bereich der sharing-economy. Es gilt ganz generell: Eine solidarische, integrierte und in Frieden lebende Gesellschaft braucht grundsätzlich weniger Ressourcen, weil die vorhandenen effizienter genutzt werden.
Über die Gesprächspartnerin
Univ.-Prof. Dr. Marina Fischer-Kowalski ist Gründerin und langjährige Leiterin des Instituts für Soziale Ökologie in Wien, Professorin für Soziale Ökologie an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und Dozentin für Soziologie an der Universität Wien. 2015 wurde sie mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. Neben zahlreichen anderen Funktionen war
sie von 2013-2016 Präsidentin der International Society for Ecological Economics oder von 2002-2010 Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Klimaforschung in Potsdam. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf den Themen Soziale Ökologie, Gesellschaftlicher Stoffwechsel, Sozialökologische Transitionen, Theorien sozialen Wandels, Umweltsoziologie und gesellschaftliche Ressourcennutzung.