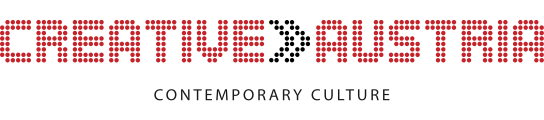Plädoyer für die Wiederentdeckung der Kreativität
— Peter Strasser
Was bleibt von der Universitas, der Idee einer umfassenden Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, in einer Zeit übrig, in der Universitäten zunehmend nach den Effizienzprinzipien großer Unternehmen am Markt organisiert werden? Welche kreativen Fähigkeiten verliert unsere Gesellschaft dadurch? Welchen „höheren“ Nutzen können die Wissenschaften hervorbringen, wenn die Hegemonie der Naturwissenschaften, die Suche nach dem „Wahren, Guten und Schönen“ – und damit auch die Arbeit in den Geisteswissenschaften – dem neoliberalen Generalverdacht der Nutzlosigkeit preisgegeben werden?
Die Karriere des Begriffs „Nerd“ ist ein Charakteristikum unserer Zeit. Dass der sogenannte Nerd ein defizitärer Charakter sei, schwer anschlussfähig, a-sozial, ein „Trottel“, geht Hand in Hand mit den Legenden von Nerds, die wegen ihrer zwanghaften Konzentration aufs Internet sowie der daraus folgenden Isolation erst ihre Kreativität entfalten konnten. Der Positivmythos vom Nerd ist ein Kommentar zur Übersozialisierung des heutigen Erkenntnisbetriebs.
War einst sprichwörtlich davon die Rede, dass Genie und Wahnsinn eng beieinanderlägen, so wird heute auf die Feststellung Wert gelegt, dass Bill Gates, einer der zugleich genialsten und geschäftstüchtigsten Köpfe unserer Epoche, in seiner Jugend ein Nerd gewesen sei. Ohne auf derartige Halblegenden großen Wert zu legen, sollte der organisierte Erkenntnisbetrieb daraus doch gewisse Lehren ziehen. Denn der Nerd liefert ein Gegenbild zu dem, was jungen Akademikerinnen mittlerweile gerne als „Exzellenzforschung“ vorgeführt wird. Sie ist durch eine Reihe von Merkmalen charakterisiert, von denen sich ohne große Übertreibung sagen lässt, dass sie Kreativität eher ersticken als fördern.
Begonnen hat es damit, dass man der Ordinarienuniversität alten Stils den Kampf ansagte. In den Talaren nistete angeblich der Staub von tausend Jahren. Das war einerseits nicht mehr zeitgemäß, doch andererseits forderte das liberalkapitalistische Modell seinen Tribut. Also setzte sich als Universitätsreform im neuen Geist langfristig nicht das antiautoritäre Modell der Achtundsechziger durch. Die Universität des 21. Jahrhunderts ist vielmehr stolz darauf, nach den Effizienzprinzipien großer Unternehmen am Markt organisiert zu sein, freilich mit der fragwürdigen Implikation, weder über Börsennotierung zu verfügen, noch Profitmaximierung zu betreiben. Was vielmehr maximiert werden soll, ist die Kreativität. Dabei genießt jene in den hard sciences, die durch enge Kooperation mit der Wirtschaft praktisch verwertbare und monetär einträgliche Produkte kreieren, naturgemäß das größte Ansehen – und gibt im Übrigen die Interaktionsrichtlinien für die Exzellenzforschung vor.
Und weil man sich vom staatlichen Gängelband emanzipieren möchte (in Wahrheit bedeutete Staatlichkeit im Erkenntnisbetrieb auch einen beträchtlichen Schutz vor Instrumentalisierung und Ausbeutung), lautet das Stichwort: Autonomie. Im Universitätszusammenhang ist das Wort eine Schönfärberei. Dahinter verbirgt sich nämlich eine straffe Hierarchisierung der Leitungsinstanzen durch alle akademischen Sektoren. Rektorat, Senat und Universitätsrat geben Schwerpunkte vor, die bis hinunter auf Dekanats- und Institutsebene verbindlich sind. Hinzu tritt eine Exekutiv- und Koordinationsbürokratie, die von allen universitären Bereichen in den letzten Jahrzehnten am schnellsten wuchs.
Dazu kommt das Element der sogenannten Drittmittelfinanzierung, das einen immer größeren Raum einnimmt. Wollen junge Forscherinnen Karriere machen, müssen sie, unter der Anleitung einer professoralen Autorität, bei den dazu eingerichteten Fonds um Projekte werben. Deren Genehmigung liegt in der Hand von Gutachterinnen, die gerade in den besonders abhängigen „Orchideenfächern“ nicht selten fragwürdige, weil stark subjektive, und praktisch unbeeinspruchbare Meinungen abgeben.
Die Wahrscheinlichkeit, sich in einer ohnehin prekären Arbeitssituation als Projektteilnehmerin zu platzieren, wächst mit der Verfügung über zwei Kompetenzen (Soft Skills), die beide der Kreativität entgegenstehen: erstens die Kompetenz sich zu „vernetzen“, in sogenannten Exzellenznetzwerken Status zu generieren; und zweitens die Kompetenz, eine genormte Wissenschaftssprache aus dem Effeff zu beherrschen, wobei es darauf ankommt, an den richtigen Stellen die richtigen terminologischen „Duftmarken“ – und nicht etwa originelle Ideen – zu setzen.
Auf diese Weise entsteht ein Forschungsbetrieb, dessen „Team“-Charakter (ein Euphemismus für autoritär geführte Projektstäbe) möglicherweise einer Denkfabrik gleicht, aber – vor allem in den soft sciences – gewiss keinen Schutzraum für Kreativität bietet. Es stapeln sich mittlerweile die Ergebnisse von Projektforschungen turmhoch, die keinerlei Erkenntniswert haben, wohl aber mit den vom System gewünschten Begrifflichkeiten gespickt sind und so den Eindruck erwecken, ein erkenntnisgenerierendes Optimierungsprogramm zu „optimieren“. Dahinter steckt der Schweiß von jungen Forscherinnen, die keine gesicherte Anstellung haben und daher auch keinen Spielraum, sich gegen den geforderten Mainstream aufzulehnen.
Laien machen sich kaum eine Vorstellung über den Normierungsdruck der Sprache, der umso stärker wird, je mehr sich die Sprachbenützerinnen der Political Correctness verpflichtet fühlen. Hier ein Ausschnitt aus einer Stellungnahme des „Fachverbandes Gender Diversity“ vom 19. August 2014, elektronisch versandt über den Universitätslehrerverband der Universität Graz:
„Bei den jüngsten persönlichen wie auch generalisierenden Angriffen gegen antidiskriminatorische Ansätze – seien es zeitgemäße, diversitätsgerechte Sexualpädagogik, gender-/diversitätsgerechte Sprache oder emanzipatorische, feministische oder andere antidiskriminatorische Positionen – geht es nicht allein um rückwärtsgewandtes Festklammern an altbewährten und bequemen, weil privilegierten, scheinbaren Sicherheiten wie vermeintlich naturgegebenen Gesellschaftsstrukturen und Sichtweisen von Welt und Wirklichkeit. Dabei geht es auch um die Fantasie, Wissenschaft bestünde im interesselosen Entdecken einer gegebenen und unveränderlichen Wahrheit.“
Man kann wohl sagen, dass einer der großen kreativitätszerstörenden Einflüsse jener war, welcher allen wissenschaftlich Begabten die Idee vom „interesselosen Entdecken einer gegebenen und unveränderlichen Wahrheit“ austreiben wollte. Denn der Ursprung jeder Kreativität liegt in einer Antriebskraft, die sich erst entfalten kann, wenn der kreative Mensch sich nicht im Dienste irgendeines Interesses betätigen muss. Tatsächlich ist es die Tugend der „Nutzlosigkeit“, die erst jenen höheren Nutzen hervorbringt, der mit der Entdeckung des Neuen im Dienste einer Suche nach dem „Wahren, Guten und Schönen“ einhergeht.
Diejenigen, die so sprechen wie in dem oben ausgestellten Zitat – und so zu sprechen gehört zu den soft skills, die jede Akademikerin beherrschen sollte, wenn sie auf eine Forscherinnenkarriere Wert legt –, ist bereits in den Dienst der „instrumentellen Vernunft“ getreten. Die Forscherin folgt damit einer Außenlenkung, die in den Sechzigerjahren viele Akademiker beklagten, allen voran Herbert Marcuse, Günter Anders, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas. Die Liste der Namen ließe sich verlängern. Dabei fällt auf, dass der Hauptanklagepunkt – „Instrumentalisierung der Wahrheit“ – dem Eindringen des naturwissenschaftlichen Erkenntnismodells in die humanities galt. Deren Hoffnung wiederum galt einem eigenen, „emanzipatorischen“ Erkenntnistyp, welcher auch für alle künstlerisch ambitionierten Unternehmungen Geltung beanspruchte.
Tatsächlich ist die Entwicklung dann ganz anders verlaufen. Während die Naturwissenschaften mit regelrecht titanischen Innovationen brillierten, von der Genetik über die Elektronik bis zur Besiedelung des Weltraums, entwickelte sich in den Geisteswissenschaften ein globalisiertes Muster: Die weltweite Vernetzung von Sprach- und damit Denkstrukturen erhöhte unter dem marktgängigen Titel „Nachhaltigkeit“ einen Gleichheitsdruck auf das schöpferische Individuum. Dieser Druck fällt nur deshalb nicht gleich ins Auge, weil es eine erkenntnisbürokratisch erwünschte Binnendifferenzierung der „Standpunkte“ mithin der weitgehend normierten Denkschulen gibt. Aus der männlich dominierten Gelehrtenrepublik ist ein ameisenhaft funktionierender Betrieb aus emsigen Kopfarbeiterinnen-Teams geworden, die ständigen Evaluierungen und regionalen Optimierungsmaximen unterliegen.
Dagegen einige herausragende Geister zu halten, die es selbstverständlich auch gibt, ist ein Ablenkungsmanöver vom Durchschnittsfall. Für den Bereich der einst sogenannten Geisteswissenschaften gälte es, wieder zu entdecken, dass Kreativität ohne jene Freiräume und institutionell gestützte Muse – ja, Muse! – unmöglich ist. Stattdessen entfaltet sich zurzeit Rhizom-artig ein Riesenkomplex symbolischer, dekonstruktiver, meta-geschichteter Denkmuster, und zwar unter dem Dach eines monotonen, geistig ausgetrockneten Akademikerenglisch.
Dieser Komplex ist – vom Freilauf in eigenen Luxuswinkeln abgesehen, welche die Gesellschaft nicht missen möchte (man will sich ja selbst glauben machen, noch immer einer tieferen, bedeutungsschaffenden Geistigkeit zugetan zu sein) – vor allem mit der Modellierung und Kommentierung umlaufender „Diskurse“ befasst. Dabei wird unter Begriffsmarkern wie „Innovation“ und „Diversity“ einer Scheinvielfalt das Wort geredet, die alles davon Abweichende in den Generaldiskurs der gleichgeschalteten Vielfalt hereinholt.
Ob sich im Rahmen einer solchen Dynamik noch substanziell Neues herausbilden kann, das eine Art geistiger Lebendigkeit zu befördern vermöchte, mag bezweifelt werden. Doch da wir, was die Zukunft betrifft, weitgehend blind sind, ist nicht auszuschließen, dass sich unter dem unerträglich gewordenen Joch der Verflachung und bürokratischen Gängelung das schöpferische Individuum schließlich wieder eine neue akademische Bühne schafft – indem es die alte mit den Mitteln des schöpferischen Geistes in die Luft sprengt. Noch ist die alte Utopie der Universitas litterarum nicht ausgeträumt …
Postskriptum: Ich, Jahrgang 1950, hatte das Glück, akademische Freiräume erleben zu dürfen, die heute weitestgehend verschwunden sind. Zugegeben, verschwunden sind auch diverse Unsitten des alten Systems. Doch um meine Kreativität, soweit vorhanden, entfalten zu können, war es erforderlich, dass mir das System „Universität“ im Laufe der Zeit gewisse Sicherheiten einräumte. Die wichtigste war meine „Pragmatisierung“. Dadurch wurde ich zu einem unkündbaren Beamten, der sich keinem Instrumentalisierungswunsch mehr beugen musste. Heute würde ich im System nicht überleben können, und leider musste ich mitansehen, dass einige meiner kreativsten Studentinnen ebenfalls nicht Fuß fassen konnten.
Der Autor
Ao. Univ.-Prof. Dr. phil. Peter Strasser, geb. 1950, lehrt an der Karl-Franzens-Universität in Graz Philosophie und Rechtsphilosophie. Von 1990 bis 1995 war er im Beirat des Avantgardefestivals „steirischer herbst“. Seit 1999 ist er auch Lektor und Gastprofessor am Institut für Philosophie der Universität Klagenfurt. Von 2002 bis 2008 war Strasser Mitherausgeber der „Bibliothek der Unruhe und des Bewahrens“ (Styria Verlag) und ab 2010 wissenschaftlicher Berater der Essayreihe „Unruhe bewahren“ beim Residenz Verlag. 2014 erhielt Peter Strasser den Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik. In seinen zahlreichen Publikationen beschäftigt sich Strasser mit Fragen der Ethik, Rechtstheorie, Kriminologie, Metaphysik und Religionsphilosophie.