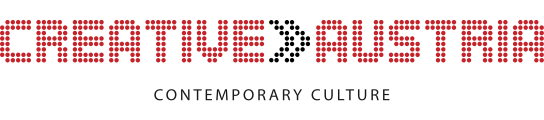Über die ethische Verantwortung der Kreativen
— Johannes Rauchenberger
Dürfen Kunst und kreatives Schaffen sich selbst genügen? Sind Kreative der Gesellschaft auch eine Leistung oder Gegenleistung schuldig? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Paradigmen der modernen Ich-Gesellschaft, in der Selbst-Optimierung, Selbst-Funktionalisierung und Effizienzmaximierung idealisiert und einer Verwertungslogik unterworfen werden, und dem kreativen Schaffen an sich?
Kunst, so scheint es, hat spätestens in jüngster Zeit das Pathos ihrer erkämpften oder auch nur mitunter inszenierten Autonomie eingebüßt. Sie sieht sich entweder genötigt, sich zu rechtfertigen oder wenigstens auf ihren spezifischen Beitrag in der aktuellen Unsicherheitssituation einzugehen. Ein Blick auf das aktuelle österreichische Kulturgeschehen genügt: Keine Intendantin, kein Intendant, keine Eröffnungsrednerin, kein Eröffnungsredner kann es sich leisten, ein Programm zu gestalten oder eine feierliche Rede zu halten, die nicht einen Bezug zur aktuellen Gegenwart mit ihren offensichtlichen Krisen aufweisen. Da ist auf dem einen Ende der Skala Angela Merkels anlässlich der plötzlich hereingebrochenen Flüchtlingskrise im September 2015 formulierter historischer Satz „Wir schaffen das“, den beispielsweise noch ein Jahr später der „steirische herbst“ in seiner Tradition, politisch avancierte Kunst herauszustellen, beinahe trotzig aufgreift, und am anderen – ja, immer wieder – das ästhetische Gegenprogramm der Kunstreligion aus dem Geiste der Romantik, das man bei der Salzburger Festspieleröffnung von Konrad Paul Liessmann gerade angesichts der Zeitprobleme – und in Abgrenzung zu diesen – zu hören bekam: Friedrich Hölderlins Parzengebet, das mit dem „Mehr bedarfs nicht“ endet. Das Kunstwerk, so das Vertrauen des damals 28-Jährigen Hölderlin, möge doch halten, trotz all der Schrecken und zerbrochener Idealismen (Napoleon und seiner Erben bis herauf zum Heute), die sie begleiten.
Mehr bedarfs
An wen auch immer man sein Gebet richtet: an die Götter der Kunst, die Parzen, den Markt, den Innovationsgeist oder an den Schöpfer selbst: Dass es „mehr bedarf“ in dieser Welt der Kunst müssen freilich fast alle zur Kenntnis nehmen, die Kunst auch zum Beruf gemacht haben. Man muss schließlich von etwas leben. Und das heißt heute: Man muss sich positionieren. Man muss Aufmerksamkeit erregen. Man muss netzwerken. Man muss das Innovative, das man eben erst hervorgebracht hat, auch kommunizieren. So nennt sich dieser Kreislauf, den man „Betriebssystem Kunst“ nennt. Wie ist darin eine ethische Verantwortung auch nur anzudenken? Kommt am Ende doch als oberste Bewertung das heraus, was Wolfgang Ullrich „Siegerkunst“¹ nannte: Kunst, die sich im System der Märkte durchgesetzt hat? Kunst und Geld waren zwar historisch immer enger verbunden, als man gerne zugeben möchte. Und doch: Die Preishengste der Kunstwelt der letzten Jahre wirken angesichts der derzeitigen Herausforderungen irgendwie alt. Man muss es also trotz der Hilflosigkeit ästhetischen Tuns sagen: Es bedarf mehr, gerade in der Kunst.
Man kann die Not, von der derzeit so viel die Rede ist, natürlich unter imperialer Kulisse inszenieren, so wie das der chinesische Starkünstler Ai Weiwei im Sommer 2016 vor dem Oberen Belvedere mit den Lotusblüten als Schwimmwesten für die Flüchtlinge über das Mittelmeer vollzogen hat. Aber man kann dasselbe auch mit den „clothes for a freezing soal“, (dem Titel eines ganz kleinen, unscheinbaren Kunstwerks aus gestrickter Wolle des Wiener Künstlers Daniel Amin Zaman), formulieren. Im Grunde ist es – bei allem Hierarchiegefälle des Kunstwerts – dasselbe. Es geht um Rettung. Um das schiere Überleben. Oder eben wenigstens um das seelische Überleben in einer Situation der Kälte. Denn die eigentlich erst im letzten Jahr wirklich zur Kenntnis genommene tragische Flüchtlingskrise – dabei sind es 65 Millionen Menschen jährlich – , das Schüren von Ängsten und das Gefühl der eigenen Unsicherheit im satten Wohlstand fordern Antworten, denen sich niemand entziehen kann. Auch und gerade die Kunst nicht. Denn der öffentliche Meinungsumschwung der jüngsten Zeit hat gezeigt: Wie selbstverständlich man Verhetzendes und dreist Vereinfachendes mittlerweile öffentlich formulieren kann. Wie schnell Sprache öffentliche Meinungen verändern kann. Wie subtil man im Zulassen dessen eine Radikalisierung der Meinungen fördert. Und wie schnell es historische Sprünge geben kann
Wider die Verwertungslogik
Dabei waren wir bislang ja mit ganz anderem beschäftigt: Jenseits dieses Bannbruchs der Sprache, der sich seit dem Ausbruch der Flüchtlingskrise in Mitteleuropa – Notstand! Obergrenze! – gezeigt hat, war doch schon viel länger ein Prozess am Werk, der sich als Breitmachen einer subtilen, scheinbar selbstverständlichen, vor allem aber einer vor nichts Halt machenden Verwertungslogik beschreiben lässt. Diese ist längst bis in die letzten Winkel unseres Daseins gedrungen: Es sind die Aufmerksamkeitsparameter in Form von Rankings im Netz und ihren Zugriffszahlen, die Likes mit ihren Bewertungsskalen, es ist aber letztlich die wirtschaftliche Nutzbarkeit, im Klartext: die Neoliberalisierung in Form von (Selbst-) Ausbeutung, (Selbst-)Optimierung, (Selbst-)Funktionalisierung, Effizienzmaximierung usw… Wir leben in einer seltsam ambivalenten Welt, in der wir „ich, ich“ zu denken und uns freiwillig zu unterwerfen und leidenschaftlich auszubeuten lernen. Und das traurigste Kapitel dabei: Die Kreativen stellen sich ganz vorne hin. Weil sie das müssen, um zu überleben. Ja, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Die antagonistischen Kräfte sind also nicht nur bei denen da draußen, sondern durchaus auch in uns selbst zu suchen.
Wie aber ihnen entkommen? Welche Strategien, um es in neoliberaler Diktion zu sagen, soll man dabei anwenden, um nicht im Handumdrehen wieder zum Teil des vereinnahmenden Systems zu werden? Denn die Verwertung jedweder Kritik ist doch auch etwas Neues. Sie nimmt ihr damit jedenfalls den Stachel. Ebenso nimmt der Zwang zur Innovation dem wirklich Neuen (Boris Groys) die Tiefe. Im Gegensatz zu früheren (und in erschreckender Weise auch wieder ganz gegenwärtigen illiberalen politischen Systemen in unmittelbarer Nachbarschaft) darf man zumindest in westlichen Gesellschaften künstlerisch so ziemlich alles formulieren. Künstlerische Freiheit ist hier in erkämpfter Weise (!) ein allerhöchstes Gut. Aber wie lange noch? Ihr Pathos von einst ist weg. Man hat sie längst domestiziert und zum Spielball der Ökonomie und der Zwangsinnovation degradiert. Was hilft Kritik, was helfen die Innovationsspritzen denn, wenn sie letztlich doch nur entweder als Spielwiese einiger weniger, öffentlich brav subventionierter Institutionen bzw. Kunstschaffender angesehen werden oder sich der alles umgreifenden Verwertungslogik unterwerfen müssen? Die entscheidenden Antriebskräfte unserer Gesellschaft liegen eben doch wo anders. Oder sie führen auch die Kräfte der Kreativen schonungslos unter ihren Agenden – sofern sie eben verwertbar sind.
Götter
Unverfügbar zu sein – das hat die Kunst verloren. In diesem Punkt ist ausgerechnet der Blick auf die Religion, von der sie sich immer wieder zu Recht emanzipiert hat, unverzichtbar. Religionen haben üblicherweise Götter. Und die Kunst hat sie früher nur allzu gerne dargestellt. Im Theater haben sie noch immer ihren Ort. Sie geben dort die Projektionsflächen für menschliche Leidenschaften ab, aber irgendwie dennoch gewaltiger, als es Menschen eben sind. Sie umspielen die Kunst des menschlichen Handelns. Aber mit ihrem Entschwinden ist auch die Kritik an ihnen weg. Und gerade die Kunst darf von einem nicht lassen: der Götzenkritik. Auch eine solche, die sie selbst betrifft. Dazu gehört auch, die jeweiligen Götter-Visionen der Zeit kritisch zu beäugen. Etwa jener der Innovation. Jede gesellschaftliche Kraft will sie sehen. Um sie dann zugleich zu vereinnahmen.
Die Unverfügbarkeit hat ja einst in einer großen Erzählung der monotheistische Gott vorgeführt: Er allein entscheidet, was recht ist. Und nicht das Goldene Kalb. Das ist die Szene der schärfsten Götzenkritik. Jener Gott bindet die Moralität an sein Ich. Diese als Gebote anzuerkennen, wird zur unbedingten Herzensangelegenheit. Das ist neu, wie der sonst den Monotheismus ob dessen latenten Gewalttendenz eher kritisierende Religionswissenschaftler Jan Assmann betont. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Tugenden einer derartigen „Menschenpflicht“ eine erstaunliche Konstanz aufweisen – über alle Religionen und Gesellschaften hinweg. Sie lauten: Menschenliebe, Gerechtigkeit, Duldsamkeit. Barmherzigkeit. Angesichts der Kampfzonen, die sich derzeit in unseren Gesellschaften mit ihren Radikalisierungen und Fundamentalismen abzeichnen, darf man sie mit Assmann durchaus „Waffen“ nennen. Oder, angesichts des Götterrückzugs in den modernen Gesellschaften deutlich abgerüstet: Prinzipien ethischen Handelns. Wer auch immer sie sich zu Herzen nimmt, die hellen Seiten der Religionen, die Staatskunst, die Künste insgesamt – nur zu.
Der Autor
Johannes Rauchenberger, geb. 1969, MMag., Dr., Kurator, Kunsthistoriker, Kulturpublizist, Theologe. Seit 2000 Leiter des Kulturzentrums bei den Minoriten in Graz Lehrbeauftragter für Kunst und Religion an den Universitäten Wien und Graz. Zahlreiche Ausstellungen, zuletzt: „Im Kampfgebiet der Poesie. Text+Bild im Widerstand“ (mit B. Pölzl, Verlag Bibliothek der Provinz 2016); zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt: „Gott hat kein Museum. Religion in der Kunst des beginnenden XXI. Jahrhunderts“ (3 Bde., 1120 Seiten, Schöningh 2015).
1 Wolfgang Ullrich: Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach 2016.